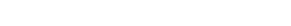Junge, komm bald wieder
Zur Serie Fahrbereitschaft von Claus Rottenbacher
Boris v. Brauchitsch, Berlin
Warum wurden Staatsgäste aus dem westlichen Ausland in der DDR nicht mit einem Wartburg oder Trabanten kutschiert? Waren sie nicht würdig, in die Automobile der Arbeiter und Bauern zu steigen? Wollte man sie spüren lassen, dass sie kapitalistische Fremdkörper und Klassenfeinde waren? Oder war es nur Rücksichtnahme auf die Sitten und Gebräuche der Gäste, die es gewohnt waren, sich in Limousinen westlichen Zuschnitts zu bewegen?
Dass den Verantwortlichen gegenüber der eigenen Bevölkerung nicht ganz wohl war bei dieser Sonderbehandlung der Fremden, zeigt die Abschottung des Geländes der Abteilung Verkehr der SED in Berlin-Lichtenberg. Hier standen die Westautos und es gab neben Garagen, Werkstatt, Tankstelle und Einsatzzentrale auch Bars, ein Casino, Sauna, Massageraum und Kegelbahn. Vehikel der Geselligkeit mit einem Hauch von Luxus in einem Niemandsland abseits vom Zentrum. Doch für wen sie eingerichtet wurden, das unterlag offenbar ebenso der Geheimhaltung, wie die gesamte Existenz der sogenannten Fahrbereitschaft.
Knapp zwanzigtausend Quadratmeter Grundfläche hat das Gelände. In vielen Teilen des Komplexes lebt auch 25 Jahre nach dem Ende der DDR noch der Geist der Ära Honecker, in der Lichtenberg eine ganz besondere Rolle spielte.
In kurzer Zeit hatte sich um das Jahr 1900 aus einem preußischen Gutsbezirk die Stadt Lichtenberg entwickelt, die 1907 die Stadtrechte verliehen bekam. Im Süden, an der Frankfurter Allee und rund um den Roedelius Platz war die bürgerliche Welt angesiedelt, während Richtung Norden bald deutlich proletarischere Strukturen spürbar wurden. Das Industriegebiet zwischen Rittergutstraße (heute Josef-Orlopp-Straße) und Herzbergstraße machte zunächst durch die Firma Gebrüder Siemens & Co von sich reden, die 1901 eine Dependance in Lichtenberg eröffnete, 1907 ganz in die Herzbergstraße zog und damit aus der frisch gekürten Stadt den marktführenden Standort für Elektrokohleproduktion in Deutschland machte. Die finstere Firmengeschichte zwischen Staublungen, Zwangsarbeit von Juden und Kriegsgefangenen im Nationalsozialismus und einer DDR-Kampfgruppen-Einheit, die unter anderem zum Schutz der Arbeiten bei der Errichtung der Berliner Mauer 1961 eingesetzt wurde, prägte lange das Image Lichtenbergs, auch wenn es während der DDR-Zeit in diesem Quartier weitere wichtige Unternehmen gab, etwa die Konsumfleischerei, die Konsumbäckerei, die Wälzlager-Fabrik Josef Orlopp und die Spirituosen-Fabrik Bärensiegel in der Rittergutstraße, oder auch den VEB Güterkraftverkehr in der Siegfriedstraße. Ab 1950 drängte sich eine andere Institution in den Vordergrund, die Lichtenberg ihren Stempel aufdrückte: das Ministerium für Staatssicherheit. Lichtenberg wurde bald zum Synonym für staatliche Spionage und Repression.
Das heutige Gesicht Lichtenbergs ist noch immer ganz wesentlich von der Stasi geprägt. Zum einen hatte sich die Zentrale zunehmend ausgebreitet, hatte auch denkmalschutzwürdige Wohngebiete zerstört und für die Nachbarschaft weitgehend Blockrandwohnstruktur im Plattenformat verordnet, die sich besser überwachen ließ, zum andern hatte sie eine Entwicklung des Stadtteils mit Verwaltungsgebäuden, Freilichtbühne, Parks und einem repräsentativen Kino verhindert, von der bis Mitte der 1960er Jahre noch immer Kommunalvertreter und Bürger zu träumen wagten. Stattdessen entstanden mehr und mehr Wohnungen für den „Apparat“, die Mitarbeiter des MfS, die bereits kurz nachdem die Wahl auf Lichtenberg als Stasi-Standort gefallen war, geradezu genötigt wurden, hierher zu ziehen. Unter anderem auch in die Neubauten an der Ecke Reinhardtsbrunner-/Siegfriedstraße, die – wie es in einem Schreiben des Magistrats an das Ministerium für Staatssicherheit hieß – „nur für in Ihren Diensten befindliche Chauffeure bestimmt sind“.
Nach der sogenannten Wende trat zunächst Lähmung ein in Lichtenberg. Als 1990 dann auch für den ehemaligen Siemens-Betrieb das Urteil „Löschung des Betriebs von Amts wegen“ lautete und die 2800 Mitarbeiter entlassen wurden, bestätigte das erneut die Rolle Lichtenbergs in der Geschichte der DDR: Von der Machtentfaltung bis zum Niedergang, vom Überwachungsstaat bis zur Abwicklung nahm der Stadtteil eine geradezu avantgardistische Position im System ein.
Die Abteilung Verkehr, die sogenannte Fahrbereitschaft, ist ein Relikt dieses Systems, das im Unterschied zu vielen anderen Bauten Berlins, die an prominenterer Stelle standen, den Nachwende-Furor überstanden hat. Es ist ein Stück DDR, aber vor allem ein Stück gesamtdeutscher Nachkriegszeit, denn auch im Westen sahen die Bauten dieser Zeit nicht sehr viel anders aus.
Schon deshalb ist es keine ‚Ostalgie‘, wenn Claus Rottenbacher sich dem Ort fotografisch annähert. Es geht ihm weder um Verklärung noch um Bloßstellung, sondern um das Einfangen und Bewahren von Atmosphäre. Die beklemmende Freudlosigkeit des Ortes spiegelt die bemühte Vitalität seiner Ära, deren Soundtrack im Rhythmus von Caterina Valente und Freddy Quinn dahin schwingt.
Die Fotografien transportieren von Pragmatismus geprägte Ensemble, die kein Bühnenbildner trefflicher erfinden könnte, sie wirken ein wenig verblichen und vermitteln den Geruch nach Amtsstube und Resopal. Sie zeigen überwiegend schäbige, fiese Null-Räume, seltsame Ecken in einer weiten Palette gedämpfter Zwischentöne, sie bergen Überraschungen, erzeugen Kälte durch formale Profanität. Sie erhellen fließende Übergänge zwischen Gebrauchsarchitektur und Abstraktion und jonglieren mit Topoi der Kunstgeschichte, wie etwa dem Perspektivspiel der Ebenen oder dem Motiv vom Bild im Bild.
Natürlich ließe sich mit dem Wissen um Lage und Bedeutung des Ortes das Post- und Schlüsselfach mit den kryptischen Kürzeln für obskure Abteilungen als Anspielung auf einen kontrollwütigen Staat lesen und die perforierten Deckenelemente in der Bar als ideales Versteck für eine flächendeckende Überwachungselektronik, aber in Wahrheit war das, was hier überdauert hat, einfach nur internationaler Standard und Ausdruck des Bemühens um ein Minimum an Modernität.
Davon, dass das Haus lange in Gebrauch war, zeugen die Eingriffe, die über die Jahrzehnte vollzogen wurden und meist ein Bedürfnis nach Gemütlichkeit spiegeln. Claus Rottenbacher streift sie in seinen sachlichen Bildern, die zwischen Dokumentation und Installation, zwischen Spurensicherung und Komposition oszillieren. Die poppigen Punkte der Sechziger Jahre, das auf der Spitze stehende konstruktive Quadrat und die romantische Fototapete der Siebziger in der Kegelbahn – sie künden vom Wunsch, es sich behaglich einzurichten, eine Lebensqualität über das rein Funktionale hinaus zu behaupten. Das setzt sich fort im gediegenen Parkett und den Design-Lampen der Bar, die besonders ins Auge fallen, wenn der Fotograf uns im selben Bild auch den Blick auf das Jenseits der Falttür eröffnet, in einen Saal, der äußerst spartanisch Minimalanforderungen an einen Ort für Vorträge, Schulungen und andere Spielarten der Belehrung erfüllt.
Gelegentlich wirken die Bilder Claus Rottenbachers modellhaft. Die verschiedenen Oberflächen, abgegriffenen Materialien und Lichtspiele machen dabei klar, dass die Realität doch immer noch interessanter ist als die abfotografierten Modelle der Künstler aus der Generation Märklin, die mit der Irritation der Maßstäbe spielen und sich dabei im Thema Virtualität recht einseitig erschöpfen. Claus Rottenbacher macht Aufnahmen, die aussehen wie eine Realität, die diesen Modellbauern als Vorbild diente für ihre Miniatur-Mimikry, welche einzig entstand, um fotografiert zu werden, um am Ende bestenfalls wieder aussehen wie Bilder Claus Rottenbachers.
Der Fotograf eröffnet Räume ohne Ausblicke, die allein von weißem Tageslicht erleuchtet sind, gelegentlich ergänzt durch die vorhandenen Deckenlampen, deren hilflose Vielfalt auf diese Weise besonders eindrucksvoll zur Geltung kommt und mit dem breiten Spektrum an Fußbodenbelägen und Deckenelementen korrespondiert. Mehrfach tauchen Spiegel auf, deren Eigenschaft, eine Reflexion zu ermöglichen, jedoch stets ins Leere läuft. Sie zeigen nichts, oder perpetuieren schmerzhaft nur das, was wir schon ohne sie sattsam vor Augen haben. Auch sie bieten kein Entkommen aus dieser Zeitkapsel. Dass es irgendwo aber doch einen Fluchtweg geben muss, das versprechen uns die Piktogramme im pflegeleicht lackierten Treppenhaus.
Der Blick des Fotografen ist ein leicht konsternierter, verblüffter Blick. Seine Aufnahmen spiegeln das Erstaunen darüber, wie tot lebendige Geschichte in Erscheinung zu treten vermag. Jedes einzelne der Bilder aber lässt sich auch als starkes Plädoyer dafür verstehen, das Untote zu retten und zu bewahren. Denn wer in dieser Atmosphäre eine Geschichtsstunde über Adenauer und Ulbricht, über den Geist eines gespaltenen Landes abhält, der braucht dafür nicht viele Worte.